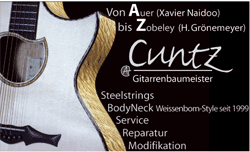Ich stelle euch mal mein Bautagebuch hier rein, das diesesmal wie eine vorher/nacher Show aufgebaut ist. Es geht um den Bau meiner zweiten klassischen Gitarre, diesmal mit Zeder als Deckenholz und wieder Cocobollo für Boden und Zargen, das Innenholz ist komplett Fichte, Griffbrett ist Ebenholz, das Kopffurnier und der Steg aus Palisander. Der Hals ist Cedro, eine spanische Zedern-Art.
Sämtliche Fotos zeigen die Teile im Rohzustand und im fertigen Zustand, teilweise auch halbbearbeitet. Und ich habe ein paar konzeptionelle Dinge miterwähnt, damit ihr lesen könnt, was so für Gedanken dahinter stehen.
Viel Spass beim Lesen!
Als erstes seht ihr hier den Stegrohling und drunter den fertigen Steg, bei dem nur noch die Auflage auf den Knüpfblock fehlt – die Idee hierzu habe ich schon, nur noch keine Zeit, sie umzusetzen. Beim Steg ist die Breite entscheidend, Standard ist ca. 19cm, ich habe 18cm genommen, da ich mit dem Steg die Decke nicht unnötig sperren will und ausserdem dann unter den Steg-Enden bei meiner Beleistung keine Fächerleisten sind. Lt. Sebastian Stenzel sind Leisten unter den Steg-Enden verantwortlich für schwache Obertöne, was eine Schwäche meiner R1 ist. Der eine cm sorgt dafür, dass die Leisten genau ausserhalb des Steges laufen und wir werden sehen, ob Stenzel recht hat!

Auf diesem Foto ist der Hals zu sehen und darunter die beiden rohen Balken und das rohe Kopffurnier. Beim Hals gibt es einmal die Kopfanleimung, die bei mir auf die einfache spanische Art gemacht ist mit einem schrägen Sägeschnitt (14°) wird die Kopfplatte an den Hals angeleimt. Das ist zu sehen an dem hellen Holzübergang am Kopf. Eine weitere Besonderheit ist die Aussparung am Halsfuss, in die die Zarge gesteckt wird, die dann mit einem Keil verklemmt und dadurch fest verleimt wird. Das habe ich von Andreas Kirschner und es ist eine sehr gute, sichere und stressfreie Art, Hals und Zarge zu verbinden.

Das nächste Foto ist das Reiffchenholz von unten nach oben roh – halbfertig gehobelt – fertig geschnitten und gebogen. Die Reiffchen werden später innen an die Zarge geleimt und dienen zur Verleimung des Bodens. Die Decke mach ich über einzelne dreickige Klötzchen, die ich noch fotografieren muss. Bei den Reiffchen ist die Besonderheit, dass die Jahresringe liegen – bei der R1 stehen sie – da ich mir davon mehr Statik verspreche.

Dann kommen wir zur Zarge, die von unten nach oben wieder roh und ca. 5mm dick- gehobelt auf 2,2mm – und gebogen und mittels Unterklotz verleimt ist. Dabei ist das Besondere die Dicke, die bei Gitarrenbauern von 1mm (Torres) bis zu 3mm (verschiedene, u.a. Kirschner) geht und damit natürlich unterschiedlich stark zur Statik beiträgt. Ich verspreche mit von den 2,2mm wie schon bei meiner R1 eine schöne weiche Spielbarkeit und ausserdem ist der Cocobollo beim Biegen dermassen widerspenstig, dass er dicker kaum zu bändigen wäre…

Weiter geht’s mit der Decke, die ihr unten roh und in zwei Hälften seht und oben im Endzustand kurz vorm „Aufschachteln“. Die Zeder wird ca. 5mm dick im Tonholzhandel verkauft und ich habe sie auf 1,5 bis 2mm gehobelt, was für Zeder die absolut unterste Grenze ist, da sie nicht so sehr stabil ist, wie Fichte, dafür aber wunderbar zu verarbeiten! Ich habe bislang nur Fichte gebaut, würde aber nun gerade Anfängern zur Zeder raten, weil die viel leichter zu bearbeiten ist.
Als Schallochverzierung kommt wieder (mein Markenzeichen) das von schwarz/weissen ringen eingefasste Bodenholz zum Einsatz. Dazu habe ich Reste des Boden so gefugt, dass ich daraus einen Ring ausschneiden konnte, bei dem kein Übergang in der Maserung mehr zu sehen ist. Schaut aus, wie aus einem Stück! (Stolz!)

Die nächsten beiden Fotos zeigen die Deckenoberfläche vor und nach der Bearbeitung, wobei ich kein einziges mal mit dem Schleifpapier drüber bin, sondern alles mit der Ziehklinge gemacht habe. Schleifpapier fällt deswegen aus, weil es das Holz zusammendrückt und die Oberfläche statisch und optisch eigentlich zerstört. Da ist ne 0,3mm dicke Ziehklinge viel besser und sogar viel schneller!

An der Schallochverziehrung sieht man noch, dass ich den Teil des Griffbretts ausgelassen habe. Das habe ich von José Romero, da dadurch später der volle Kontakt zwischen Griffbrett und Decke erhalten bleibt und das angeblich die Schwingungsübertragung vom Bundstab zur Decke in den hohen Lagen entscheidend verbessert – mal sehen!

So, dann kommen wir zum Beleistungsholz, das von links nach rechts im groben Stück, in Leisten zersägt, fein gehobelt und auf Grundstärke gebracht und schliesslich auf die Decke geklebt und teilweise schon fertig verschnitten zu sehen ist. Die quer geleimten Deckenbalken werden noch verschnitten.
Folgende Besonderheiten: Beleistung immer mit stehenden Jahresringen, die letzte Bass- und Diskant-Fächerleiste geht unter dem Hauptbalken durch und soll die Decke im Bereich des Schallochs noch zu obertönigen Schwingungen verleiten. Ein schräger Hauptbalken soll einen kürzeren Diskant- (links) und einen längeren Bassbereich (rechts) herstellen, analog der Schwingungslänge.
Die Beleistung ist im Bau der wohl meist diskutierte Bereich einer Gitarre und es gibt nicht DIE Beleistung (sonst gäbe es nur gute Gitarren) und mit den unterschiedlichsten Systemen entstehen hervorragende Gitarren. Mal sehen, wie meine Eigenkonstruktion wird, die ich so ähnlich bei der R1 schon verbaut habe und die aus folgenden Anregungen besteht: 7er Fächer und durchgehende Bass- und Diskantleiste von Torres, schräger Deckenbalken von Martin und aus dem X-Bracing entnommen, Schallochunterfütterung ist üblich, neben dem Schalloch der schräge Balken im Diskantbereich und der kleine Fächer im Bassbereich sind eigene Ideen.

Und schliesslich und endlich noch der Boden, der ebenfalls 2,2mm stark ist, mit einer Fugleiste in der Mitte – weil der Boden leicht verzogen war und ich die Leimfuge unterstützen wollte. Normalerweise macht man die Fugleiste nur bei Einsatz eines Zierspanes in der Mitte. Ansonsten ist der Boden mit drei Querbalken beleistet, die so gehobelt sind, dass er um etwa 5mm gewölbt ist. Versucht mal, ein Blatt Papier auf den Tisch zu stellen, es geht nur, wenn ihr es wölbt – diesen Effekt benutzt man auch beim Gitarrenboden für viel mehr Statik. Die Balken habe ich dieses mal total robust gemacht, weil ich einen sehr stabilen Boden haben will. Dann habe ich bei Kenny Hill gesehen, dass er den Boden noch mit kleinen Leisten absperrt, damit er möglichst wenig schwingt und dafür die Schallschwingungen im Innenraum besser reflektiert. Das führt laut ihm zu einer viel höheren Lautstärke – wie werden es hören!

Soweit bin ich nun. Es gibt bald einen zweiten Teil, in dem ich dann die hier vorgestellten Einzelteile alle zusammenbaue (aufschachteln sagt man dazu) und bis dahin ein wenig Geduld!
Viel Spass beim Üben!