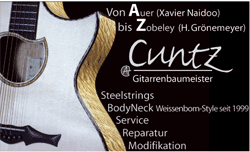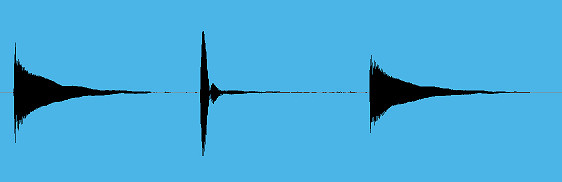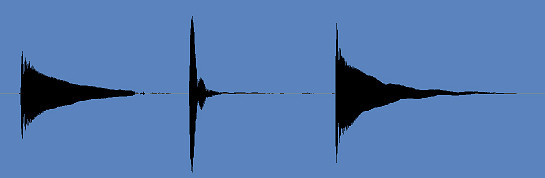Ja, ja, die Sache mit dem Halbwissen…ich bekenne mich dazu.

Bin kein Physiker
und will auch keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Meine Erkenntnisse
beruhen weniger auf Theorien sondern mehr auf ganz praktischen Erfahrungen.
Unter dieser Prämisse also noch ein paar Details:
Ich besitze derzeit 13 Akustikgitarren und alle (!) haben einen Deadspot. Und der
liegt mal beim F, beim Fis, beim G, beim Gis und bei zwei Instrumenten gar beim A.
Natürlich jeweils fix und nicht variabel. Und deshalb bleibt er da auch erhalten, wenn
ich die Gitarre höher oder tiefer stimme. Dann verrutscht er halt in die andere Lage.
TorstenW hat geschrieben:(Du kannst ja mal aus Witz die beiden E-Saiten auf F hochstimmen und dann nochmal
das F auf der A- oder D-Saite anschlagen. Wunder, oh Wunder, es ist kein Deadspot mehr..)
Oh doch, bei meinen Gitarren ändert das gar nix!
Ausgeprägte Deadspots sind so gut zu hören, dass ich die anderen Saiten dazu gar nicht
abdämpfen muss. Das Mitschwingen anderer Saiten ist auch oft nicht relevant, weil es
eben nicht um angeregte Obertonresonanzen geht, sondern um den plötzlich absterbenden
Grundton. Und da macht es manchmal tatsächlich eben nur Plopp statt ordentlich Bommmmm.
Insofern nützt da auch langes ausklingen lassen wenig. Der Grundton ist weg und es bleiben
nur die relativ dünnen Obertöne. Um dem Deadspot gut auf die Spur zu kommen, empfiehlt
es sich, die Saite nicht mit Nagel oder Plektrum anzuschlagen, sondern mit weicher aber
nicht kraftloser Daumen-/Fingerkuppe, vorzugsweise nahe dem Griffbrettende über dem
Schallloch.
Spüren kann man den Deadspot, so würde ich das in halbwissender Laienmanier

beschreiben, weil der angeschlagene Grundton den Klangkörper in seiner Eigenresonanz
anregt und der ihm vibrierend gleichsam die tonale Energie entzieht (Oha, ich gerate ins
Schwärmen) Denn vibrieren soll der Korpus eigentlich nicht. Insbesondere Boden und
Zargen sollen den Ton vielmehr ungerührt reflektieren.
Und ja, TorstenW, ich unterstelle, meine Gitarren mit gleicher Grundresonanzfrequenz
haben alle den gleichen Deadspot und umgekehrt. Dass der aber dabei nicht stets gleich
stark ist, liegt an der individuellen Abstimmung der Instrumente, in die die Gitarrenbauer
zuweilen sehr viel Knowhow stecken. Außerdem ist es oft so, dass der Deadspot zwar
auf derselben Note liegt, aber nicht auf allen Saiten und/oder in allen Lagen gleich intensiv
ist. Wie ich in den verlinkten Beiträgen im Konzertgitarrenforum schon schrub, hat mir der
Gitarrenbauer Christian Stoll mal erzählt, dass er immer versucht, den Deadspot zwischen
zwei Halbtöne zu legen, damit er möglichst wenig stört. Natürlich habe ich auch schon
Instrumente gespielt, die keinen toten Ton zu haben schienen. Aber wenn man dann
ganz in Ruhe aufmerksam testet, findet man ihn meistens doch. Nun möchte ich
niemanden animieren, verzweifelt danach zu suchen. Wenn er im normalen Spiel nicht
auffällt, ist alles gut. Sonst muss man sich bemühen, die Problemzone mit geschickten
Fingersätzen zu „umspielen“.
Die Grundresonanzfrequenz oder Hohlraumresonanz wird auch Helmholtzresonanz
genannt. Ein paar Details u.a. dazu erfährt man in verständlicher Sprache z.B. in
einem Interview mit dem Gitarrenbauer Urs Langenbacher:
Tradition und angewandte Physik im Dienste des Gitarristen.
Da findet sich auch ein netter Tipp zum Feststellen der Resonanzfrequenz:
Ins Schalloch singen, bis bei der Luftresonanz der gesamte Korpus resoniert.
Na denn fröhliches Singen...