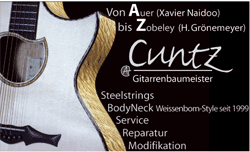Stimmton
Moderatoren: jpick, RB, Gitarrenspieler
-
Gast
Stimmton
Hallo,
ich hab vor kurzem mal gelesen, dass 1788 das a die sog. Pariser Stimmung 409Hz hatte. Dann gab es noch verschiedene andere Stimmungen bis zum heutigen 440Hz bei einer Temperatur von 20°C.
Jetzt frag ich mich, welche Stimmung für das a hatte zum Beispiel J.S.Bach?
Kann man sich sicher sein, dass man ein Stück aus dieser Zeit heute genauso spielt, wie es ursprünglich geklungen hat?
Vielleicht ist die Frage ja auch dumm, aber sowas soll es ja angeblich gar nicht geben...
ich hab vor kurzem mal gelesen, dass 1788 das a die sog. Pariser Stimmung 409Hz hatte. Dann gab es noch verschiedene andere Stimmungen bis zum heutigen 440Hz bei einer Temperatur von 20°C.
Jetzt frag ich mich, welche Stimmung für das a hatte zum Beispiel J.S.Bach?
Kann man sich sicher sein, dass man ein Stück aus dieser Zeit heute genauso spielt, wie es ursprünglich geklungen hat?
Vielleicht ist die Frage ja auch dumm, aber sowas soll es ja angeblich gar nicht geben...
Bin kein Spezialist aber ich habe schon gehört das manche Orkester historisch stimmen damit Geigen und andere Instrumente ihr Bestes geben.
Allerdings kann man nicht ganz sicher sein das man es "wie damals" spielt. Und Musik für mich ist etwas fügiges, es soll wie "Heute" klingen, mit Respekt auf "Damals".
Heiliger Wikipedia meint:
Kammerton
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Kammerton ist der gemeinsame Ton, auf den die Instrumente einer Musikgruppe eingestimmt werden. 1939 wurde auf einer internationalen Stimmtonkonferenz in London die Frequenz von 440 Hz bei 20 °C für das eingestrichene a, den Ton a’, festgelegt (Standard ISO 16).
Die Vorsilbe „Kammer-“ bezieht sich auf fürstliche Privatgemächer, in denen früher musiziert wurde. Daher gibt es historisch betrachtet einen Gegensatz zwischen „Kammer“- und „Kirchenton“, wobei letzterer bis zu einem ganzen Ton höher war. Diese Unterscheidung verlor sich nach 1800.
Aber auch der Kammerton war nicht zu allen Zeiten gleich. In Deutschland lag er im 17. und 18. Jahrhundert häufig bei 415 Hz, im Italien des 17. Jahrhunderts bei 466 Hz und im Frankreich des 18. Jahrhunderts auch bei 392 Hz. 1788 entstand außerdem in Paris die sogenannte Pariser Stimmung, die auf 409 Hz festgelegt wurde. Im 19. Jahrhundert stieg der Kammerton immer mehr, und um 1890 waren vielerorts schon 490 Hz erreicht.
Die klassische Methode, den Kammerton anzugeben, ist die Stimmgabel; alternativ gibt es auch Stimmpfeifen. Heutzutage immer verbreiteter werden elektronische Stimmgeräte. In manchen Telefonnetzen (z.B. in Österreich) hat auch das Freizeichen als Service für Musiker 440 Hz; im Netz der Deutschen Telekom liegt das Freizeichen allerdings einen Viertelton tiefer. In Österreich bietet die Telekom Austria den Kammerton unter einer Servicenummer an (+43 1 1507), was weltweit einzigartig ist.
Nicht nur in der bundesdeutschen Orchesterlandschaft hat sich zurzeit – unabhängig vom nach wie vor international gültigen Standard von 440 Hz – die Frequenz von 443 Hz als Kammerton eingebürgert. Dieser wird zu Beginn der Probe bzw. der Aufführung von der Oboe angegeben, vom Konzertmeister abgenommen (d.h. dieser stimmt seine Geige auf diesen Ton) und dann ans Orchester "weitergereicht".
In anderen Ländern sind auch Stimmhöhen von 440 Hz bis 446 Hz üblich, beispielsweise herrscht in Italien ein Stimmton von 442 Hz vor.
Für die Musizierpraxis auf historischen Instrumenten wird häufig ein Kammerton von 415 Hz (das ist gegenüber 440 Hz etwa einen Halbton tiefer) verwendet.
Allerdings kann man nicht ganz sicher sein das man es "wie damals" spielt. Und Musik für mich ist etwas fügiges, es soll wie "Heute" klingen, mit Respekt auf "Damals".
Heiliger Wikipedia meint:
Kammerton
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der Kammerton ist der gemeinsame Ton, auf den die Instrumente einer Musikgruppe eingestimmt werden. 1939 wurde auf einer internationalen Stimmtonkonferenz in London die Frequenz von 440 Hz bei 20 °C für das eingestrichene a, den Ton a’, festgelegt (Standard ISO 16).
Die Vorsilbe „Kammer-“ bezieht sich auf fürstliche Privatgemächer, in denen früher musiziert wurde. Daher gibt es historisch betrachtet einen Gegensatz zwischen „Kammer“- und „Kirchenton“, wobei letzterer bis zu einem ganzen Ton höher war. Diese Unterscheidung verlor sich nach 1800.
Aber auch der Kammerton war nicht zu allen Zeiten gleich. In Deutschland lag er im 17. und 18. Jahrhundert häufig bei 415 Hz, im Italien des 17. Jahrhunderts bei 466 Hz und im Frankreich des 18. Jahrhunderts auch bei 392 Hz. 1788 entstand außerdem in Paris die sogenannte Pariser Stimmung, die auf 409 Hz festgelegt wurde. Im 19. Jahrhundert stieg der Kammerton immer mehr, und um 1890 waren vielerorts schon 490 Hz erreicht.
Die klassische Methode, den Kammerton anzugeben, ist die Stimmgabel; alternativ gibt es auch Stimmpfeifen. Heutzutage immer verbreiteter werden elektronische Stimmgeräte. In manchen Telefonnetzen (z.B. in Österreich) hat auch das Freizeichen als Service für Musiker 440 Hz; im Netz der Deutschen Telekom liegt das Freizeichen allerdings einen Viertelton tiefer. In Österreich bietet die Telekom Austria den Kammerton unter einer Servicenummer an (+43 1 1507), was weltweit einzigartig ist.
Nicht nur in der bundesdeutschen Orchesterlandschaft hat sich zurzeit – unabhängig vom nach wie vor international gültigen Standard von 440 Hz – die Frequenz von 443 Hz als Kammerton eingebürgert. Dieser wird zu Beginn der Probe bzw. der Aufführung von der Oboe angegeben, vom Konzertmeister abgenommen (d.h. dieser stimmt seine Geige auf diesen Ton) und dann ans Orchester "weitergereicht".
In anderen Ländern sind auch Stimmhöhen von 440 Hz bis 446 Hz üblich, beispielsweise herrscht in Italien ein Stimmton von 442 Hz vor.
Für die Musizierpraxis auf historischen Instrumenten wird häufig ein Kammerton von 415 Hz (das ist gegenüber 440 Hz etwa einen Halbton tiefer) verwendet.
Ich habe noch folgendes gefunden, hoch interessant eigentlich, gibt es mir doch erneut Anlaß über meine Idee nachzudenken, die Gitarren versuchsweise tiefer zu stimmen, beispielsweise einen Halbton, also ca. 415 Hz.
In der abendländischen Musikkultur sind Klagen über zu hohe Stimmungen gewiss nicht neu, schwankte doch die Tonhöhe schon vor der Romantik im Unfang einer Sext. Mittelalterliche Orgeln, von dem Physiker Alexander Ellis um 1875 vermessen, wiesen Tonhöhenunterschiede von a´ 505,8 Hz (Halberstadt um 1361) und a´ 374,3 Hz (Lille um 1700) auf.
Hier handelte es sich aber wie bei heutigen Blasinstrumenten weitgehend um technische und Intonationsprobleme, die bei höherer Stimmung kontrollierbarer sind. Doch selbst Opern- und Orchesterstimmungen schwankten enorm. 1790 spielte die Berliner Philharmonie um Tonhöhe a' 422 Hz. 1820 galt in Paris das Diapason-Normal mit 423 Hz als Ideal, um bis 1859 auf a' 435,4 Hz zu steigen. Im gleichen Jahr spielten die Wiener Philharmoniker Ihr a' um 451,7 Hz. Übrigens: die Stimmgabel W.A. Mozarts hatte eine Tonhöhe von 421,6 Hz und G.F. Händel's auch "nur" 422,5 Hz.
Auf Initiative von Giuseppe Verdi wurde 1884 ein Dekret erlassen, nach dem italienische Militärkapellen mit Stimmton kleines c 128 Hz (entspricht c´ 256 Hz bzw. a´ 432 Hz) zu spielen haben. Seitdem gab es immer wieder den Versuch, die Tonhöhen human zu halten. Bis heute jedoch stieg die in großen Orchestern gespielte Tonhöhe a´ auf 442 - 446 Hz. Parallel dazu erhöhte sich der durchschnittliche Lautstärkepegel seit 1950 um nahezu 20% auf 86 Dezibel. Diese Steigerung betrifft alle Instrumente, besonders aber - bis zu 30 db gegenüber 1950 - alle Saiteninstrumente
dank besserer Legierungen unter Erhöhung der Zerreißgrenzen mit gleichzeitiger Verbesserung der statisch-akustischen Einheit. Damit entfernen wir uns auch bei der Lautstärke immer weiter von den in Noten gesetzten Klangvorstellungen der Komponisten vergangener Jahrhunderte.
Bei tieferer temperierter Stimmung ergibt sich für unsere Wahrnehmung ein angenehmer Nebeneffekt: Wir erhalten bei der Spreizung der Oktaven mehr Freiraum von "warm" bis "brillant". Mehr oder weniger Spreizung lässt Raum für stärker oder schwächer hervortretende Obertonspektren. Die Intervall-Gesetzmäßigkeiten lassen dabei alle Differenztöne klar und offen mitklingen, so wie es ab a´ 440 Hz aufwärts nur noch barocke Stimmungsarten vermögen. ...........
Um 1990 wurde in Testreihen festgestellt, dass bis zu 90 % der Probanden ähnlich empfanden:
• " Musik auf Tonhöhe a´ 432 Hz mache frei und verleihe harmonisches Wohlbefinden;
• " Musik auf Tonhöhe a´ 440 Hz wird als brillant, aber als gespannt-nervösmachend empfunden;
• " Musik auf Tonhöhe a´ 443 Hz und darüber wirkt aggressiv und belaste das vegetative Nervensystem bis hin zu physischen Qualen.
.............
Ich habe neben vielen älteren Instrumenten etliche neue Klaviere (u.a. der Marken: BLÜTHNER, ESTONIA, FÖRSTER, PFEIFFER, RÖNISCH, STEINGRAEBER und STEINWAY&SONS) auf a´ 432 Hz bis a´ 437 Hz gestimmt. Bisher hat jeder, der diesen Klang gehört hat, bestätigt, dass die Tonhöhen über a´ 440 Hz im Vergleich dazu geradezu geschlechtslos sind. ..........
Zum "Einhören" finden Kunden in unserem Geschäft tief gestimmte Instrumente. Sie werden von deren Klangreichtum begeistert sein - und das ohne Änderung von Statik und Saitenstärken!
Wie sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie in letzter Zeit ein Konzert mit tiefer Stimmung erlebt? Ich freue mich auf regen Austausch und "begreifbare" Fortschritte in der Musikkultur... Hoffentlich erreiche ich viele meinungsbildende Persönlichkeiten (Musiker, Therapeuten, Ärzte
etc.), die sich unvoreingenommen mit dem Thema auseinandersetzen - zum Wohle der Musik und der Menschen!
Mannheim, im April 2003
Andreas Weng Klavierbaumeister
Zuletzt geändert von RB am Di Mär 14, 2006 11:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gast
Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die Oboe den Ton vorgibt? Vielleicht bekommt dieses Instrument keine 440Hz hin.
Nur so ein Gedanke.
Edit: Wow, da lag ich ja gar nicht so falsch.
Übrigends stimmt Tommy Emmanuel seine Gitarren auch immer so in die Gegend von 430-435Hz.
Nur so ein Gedanke.
Edit: Wow, da lag ich ja gar nicht so falsch.
Übrigends stimmt Tommy Emmanuel seine Gitarren auch immer so in die Gegend von 430-435Hz.
-
Gast
Wow. Danke RB. Hier wird ja meine Frage auf den Punkt beantwortet.RB hat geschrieben:Ich habe noch folgendes gefunden, hoch interessant eigentlich, gibt es mir doch erneut Anlaß über meine Idee nachzudenken, die Gitarren versuchsweise tiefer zu stimmen, beispielsweise einen Halbton, also ca. 415 Hz.
In der abendländischen Musikkultur ...
Ich werde mein Stimmgerät mal gleich auf Werte unter 432Hz einstellen.
Hallo,Chet hat geschrieben:Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die Oboe den Ton vorgibt? Vielleicht bekommt dieses Instrument keine 440Hz hin.
Nur so ein Gedanke.
Edit: Wow, da lag ich ja gar nicht so falsch.
Übrigends stimmt Tommy Emmanuel seine Gitarren auch immer so in die Gegend von 430-435Hz.
ich habe mich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt, was die Stimmung von TE angeht, in seinem Buch beschreibt er, das er sie auf 444Hz stimmt, sowie auch Eric Roche in seiner Guitar Bible.
Zitat aus Guitar Bible: Both Players feel that this slight shift in pitch enhances the clarity tone of the instrument
Ich stimme sie gleich einen Halbton höher, aber was das dann in Hz ist...?
Wie auch sei, durchs höher stimmen gewinnt meine Mouse ähh Geliebte.
Gruß John
-
Gast
EchtZupfer hat geschrieben:Hallo,Chet hat geschrieben:Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass die Oboe den Ton vorgibt? Vielleicht bekommt dieses Instrument keine 440Hz hin.
Nur so ein Gedanke.
Edit: Wow, da lag ich ja gar nicht so falsch.
Übrigends stimmt Tommy Emmanuel seine Gitarren auch immer so in die Gegend von 430-435Hz.
ich habe mich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt, was die Stimmung von TE angeht, in seinem Buch beschreibt er, das er sie auf 444Hz stimmt, sowie auch Eric Roche in seiner Guitar Bible.
Zitat aus Guitar Bible: Both Players feel that this slight shift in pitch enhances the clarity tone of the instrument
Ich stimme sie gleich einen Halbton höher, aber was das dann in Hz ist...?
Wie auch sei, durchs höher stimmen gewinnt meine Mouse ähh Geliebte.
Gruß John
Mir war so als wenn er in einem der Videos auf seiner Seite etwas von 430-435Hz gesagt hätte. Aber dann hab ich mich wohl verhört, denn für das Buch wird man da wohl etwas genauer nachgefragt haben.
Danke für den Hinweis.
Edit: Ja, hab grad noch mal in dieses Video reingeschaut. In der Tat, er sagt auch dort, dass er 444Hz benutzt.
Sorry for that.
Viele Grüße
Tom
[quote="Chet"]@Zupfer
Cool, du spielst Maton?
Welches Modell spielst du denn?
Spielte die Maton EBG 808 TE Artist, habe mich damals vom TE Video sehr, wie sagt man , verleiten lassen.
Dann folgte LJ, seine M.... wäre zu kostspielig gewesen, habe daraufhin,
nicht nur wegen LJ, mir eine OM 21 zugelegt.
Ich habe in den letzten Jahren eine Tour de Guitar hinter mir, immer ca. 1-2 Jahre gespielt und dann mir wieder eine neue zugelegt.
Mal habe ich was verdient, mal musste ich den Verlust als Leihgebühr deklarieren.
Aber zur Zeit glaube ich, ist es schwieriger geworden seine Gitarre an den Mann zu bringen.
Zumindest die eigene Preisvorstellung zu realisieren.
Gruß John
Cool, du spielst Maton?
Welches Modell spielst du denn?
Spielte die Maton EBG 808 TE Artist, habe mich damals vom TE Video sehr, wie sagt man , verleiten lassen.
Dann folgte LJ, seine M.... wäre zu kostspielig gewesen, habe daraufhin,
nicht nur wegen LJ, mir eine OM 21 zugelegt.
Ich habe in den letzten Jahren eine Tour de Guitar hinter mir, immer ca. 1-2 Jahre gespielt und dann mir wieder eine neue zugelegt.
Mal habe ich was verdient, mal musste ich den Verlust als Leihgebühr deklarieren.
Aber zur Zeit glaube ich, ist es schwieriger geworden seine Gitarre an den Mann zu bringen.
Zumindest die eigene Preisvorstellung zu realisieren.
Gruß John
- Liederbolt
- Beiträge: 449
- Registriert: Sa Aug 18, 2012 2:57 pm
- Wohnort: Bremen
- Kontaktdaten:
Habe mal bei einer Entrümpelung eine alte Tongabel gefunden, die mit á = 435 Hz schwingt - die nehme ich sehr gerne für meine Gitarrenlaute. Passt so genau in die Zeit, da dieser Ton von 1885-1939 internationaler Stimmton war - genau die Epoche der Wandervögel mit ihren Zupfgeigen.
Auf Lauten (und sicher auch auf historischen Gitarren) wurde es ganz früher so gemacht, dass die höchste (Darm)Saite so hoch gezogen wurde "...als sies lyden mag" (Ludwig Iselin in einer Handschrift von 1575). Das war wahrscheinlich so ca. ~1 Ganzton unter der Zerreissgrenze. Einen verbindlichen Stimmton brauchte man nur im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten.
Auf Lauten (und sicher auch auf historischen Gitarren) wurde es ganz früher so gemacht, dass die höchste (Darm)Saite so hoch gezogen wurde "...als sies lyden mag" (Ludwig Iselin in einer Handschrift von 1575). Das war wahrscheinlich so ca. ~1 Ganzton unter der Zerreissgrenze. Einen verbindlichen Stimmton brauchte man nur im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten.
"Mit Harrfen und Lauten schönen Metzen hofieren, solches nimmt ein böses Ende"
Reformator Johann Mathesius 1560
Reformator Johann Mathesius 1560
-
fretworker
- Beiträge: 513
- Registriert: Sa Jul 14, 2007 1:04 pm
Ganz einfach: Das Orchester – oder auch Soloinstrumente – werden lauter und durchsetzungsfähiger. Orchesterstimmungen gehen heute bis 444 Hz, teilweise auch noch höher. Alte Instrumente leiden darunter bzw. kommen gar nicht so hoch (v.a. Bläser).RB hat geschrieben:Aber wie kommt man bloß auf die Idee, von 440 Hz auf 443 Hz umzustellen ? Ich kann mir den sittlichen Nährwert einer solchen Veränderung nicht vorstellen.
Auf die Gitarre bezogen: Die meisten sind auf einen Kammerton von 440-442 Hz ausgelegt. Deutlich höher würde ich aus Stabilitätsgründen vermeiden, vor allem bei leichten Instrumenten, deutlich tiefer klingt häufig schlapp. Hängt ab, wie immer, auch von der Bauweise ab.
Gruß, fretworker
Bach konnte nur das nehmen was da war, z.B. Silbermannorgeln.Jetzt frag ich mich, welche Stimmung für das a hatte zum Beispiel J.S.Bach?
Silbermanns Grundsätze wurden nicht von jedem befürwortet. Die Kritik des Zeitgenossen Johann Sebastian Bach ist ein Beispiel dafür. Bach forderte eine erweiterte, flexiblere Stimmung, Silbermann beharrte jedoch auf dem mitteltönigen Stimmungssystem. Zum anderen monierte Bach den schwergängigen Anschlag der Hammerflügel Silbermanns und die unzureichende Klangstärke im oberen Tonbereich. Andererseits wurden Bach und Silbermann jedoch auch gemeinsam als Orgelsachverständige verpflichtet, zum Beispiel 1746 bei der Abnahme der neugebauten Hildebrandt-Orgel in der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel.