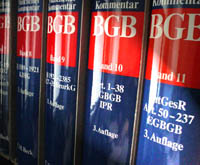

Schadensersatzpflicht
des Käufers
bei unberechtigter Mängelrüge
(Vertragsverletzung, PVV)
Bundesgerichtshof
Az: VIII ZR 246/06
Urteil vom 23.01.2008
Der VIII. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2007 für
Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil der Zivilkammer 7 des
Landgerichts Hildesheim vom 11. August 2006 wird zurückgewiesen.
Die Beklagte hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin verkaufte und lieferte im Februar 2003 an die Beklagte eine
Lichtrufanlage, mit der von Krankenbetten aus Rufsignale an das
Pflegepersonal mittels Leuchtzeichen an der Zimmertür sowie mittels
akustischer Zeichen an einzelne Pflegekräfte gesendet werden können. Die
Anlage wurde von der Beklagten, die ein Elektroinstallationsunternehmen
betreibt, in einen Neubautrakt eines Altenheims eingebaut, wobei auch eine
Verbindung zu einer bereits bestehenden Rufanlage im Altbau herzustellen
war. Auf eine Störungsmeldung des Altenheims hin überprüfte der
Mitarbeiter R. der Beklagten am 19. August 2003 die Installation der Anlage,
konnte aber die Störung nicht beseitigen. Daraufhin forderte die Beklagte
die Klägerin auf, den von ihr als Ursache der Störung vermuteten Mangel an
der gelieferten Lichtrufanlage zu beheben. Der Servicetechniker K. der Klägerin,
der die Anlage am 25. August 2003 an Ort und Stelle überprüfte,
bezeichnete als maßgebliche Ursache der Störung die Unterbrechung einer
Kabelverbindung zwischen der alten und der neuen Rufanlage, die er behob. Für
die Überprüfung der Anlage und die Fehlerbeseitigung benötigte er
einschließlich der Zeit für die Hin- und Rückfahrt, bei der er insgesamt
424 km mit dem PKW zurücklegte, sechs Arbeitsstunden.
Mit ihrer Klage verlangt die Klägerin von der Beklagten Ersatz der ihr zur
Beseitigung des vermeintlichen Mangels entstandenen Kosten nebst Zinsen. Das
Amtsgericht hat der Klage in Höhe eines Teilbetrags von 773,95 EUR nebst
Zinsen stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Mit
ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebt die Beklagte
weiterhin die vollständige Abweisung der Klage.
Entscheidungsgründe:
Die Revision hat keinen Erfolg.
I.
Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt:
Der Klägerin stehe gegenüber der Beklagten ein Anspruch auf Schadensersatz
aus § 280 Abs. 1, §§ 249 ff. BGB in Höhe von 773,95 EUR nebst Zinsen zu.
Die Beklagte habe als Käuferin ihre nachvertragliche Pflicht verletzt, die
Klägerin durch ungerechtfertigte Mangelbeseitigungsaufforderungen nicht in
ihrem Vermögen zu schädigen. Ein Mangel der von der Klägerin gelieferten
Anlage im Sinne von § 434 BGB habe nicht vorgelegen. Die Beklagte habe die
ungerechtfertigte Inanspruchnahme der Klägerin auch zu vertreten. Selbst
wenn entgegen den Feststellungen des Amtsgerichts die Störung ursprünglich
nicht auf das Fehlen einer Kabelverbindung zwischen der alten und der neuen
Rufanlage, sondern - wie die Beklagte geltend mache - darauf zurückzuführen
gewesen sei, dass die Schwestern des Pflegeheims Veränderungen an der
Einstellung der Anlage vorgenommen hätten, und der Mitarbeiter R. der
Beklagten die Verbindung erst bei Überprüfung der Anlage gelöst sowie
danach vergessen habe, den Draht wieder anzuschließen, sei es fahrlässig,
dass die Beklagte als Fachfirma für Elektroanlagenbau sowie für Alarm- und
Brandmeldetechnik vor Inanspruchnahme der Klägerin die nahe liegende Möglichkeit
einer Fehlfunktion infolge der Vornahme von Einstellungen durch das
Pflegepersonal nicht überprüft habe. Die Klägerin habe deshalb Anspruch
auf Erstattung der entstandenen Kosten in Höhe von 6 Arbeitsstunden à 90
EUR, weil die Beklagte ihr die Möglichkeit genommen habe, den Zeugen zu
diesen Stundensätzen anderweitig einzusetzen (§§ 249, 252 BGB), und auf
Ersatz von Fahrtkosten in Höhe von 0,30 EUR x 424 km zuzüglich 16 %
Umsatzsteuer, insgesamt 773,95 EUR.
II.
Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. Das
Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Klägerin von der
Beklagten Schadensersatz wegen ihrer Aufwendungen für die Beseitigung der
Störung der Rufanlage in Höhe von 773,95 EUR verlangen kann; denn die
Beklagte hat mit ihrer Aufforderung zur Mangelbeseitigung gegenüber der Klägerin
schuldhaft eine vertragliche Pflicht verletzt (§ 280 Abs. 1 BGB).
1. Der Beklagten stand ein Anspruch auf Nacherfüllung in Form der
Mangelbeseitigung gemäß § 437 Nr. 1, § 439 BGB gegenüber der Klägerin
nicht zu. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen und in der Revisionsinstanz
nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts wies die von der Klägerin
gelieferte Rufanlage keinen Sachmangel im Sinne von § 434 BGB auf.
2. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist, wie die Revision zu
Recht geltend macht, anerkannt, dass allein in der Erhebung einer Klage oder
in der sonstigen Inanspruchnahme eines staatlichen, gesetzlich geregelten
Rechtspflegeverfahrens zur Durchsetzung vermeintlicher Rechte weder eine
unerlaubte Handlung im Sinne der §§ 823 ff. BGB (BGHZ 74, 9, 16; 95, 10,
18 f.; 118, 201, 206; 154, 269, 271 f.; 164, 1, 6) noch ein Verstoß gegen
Treu und Glauben und damit eine zum Schadensersatz verpflichtende
Vertragsverletzung gesehen werden kann (BGHZ 20, 169, 172; BGH, Urteil vom
20. März 1979 - VI ZR 30/77, WM 1979, 1288 = NJW 1980, 189, unter I 2,
insoweit in BGHZ 75, 1 nicht abgedruckt; Urteil vom 12. November 2004 - V ZR
322/03, NJW-RR 2005, 315 unter II 2). Für die Folgen einer nur fahrlässigen
Fehleinschätzung der Rechtslage haftet der ein solches Verfahren
Betreibende außerhalb der schon im Verfahrensrecht vorgesehenen Sanktionen
grundsätzlich nicht, weil der Schutz des Prozessgegners regelmäßig durch
das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung
gewährleistet wird. Eine andere Beurteilung würde die freie Zugängigkeit
der staatlichen Rechtspflegeverfahren, an der auch ein erhebliches öffentliches
Interesse besteht, in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise einengen.
Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen sich diese Rechtsprechung
auf die außerprozessuale Geltendmachung vermeintlicher Rechte übertragen lässt,
wird jedoch nicht einheitlich beantwortet.
a) Nach der Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen vom 15. Juli
2005 (BGHZ 164, 1, 6) bleibt es beim uneingeschränkten deliktischen Rechtsgüterschutz
nach § 823 Abs. 1 BGB und § 826 BGB, wenn es an der Rechtfertigungswirkung
eines gerichtlichen Verfahrens fehlt. Im Rahmen einer (vor-)vertraglichen
Beziehung der Parteien kommt nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom
12. Dezember 2006 (VI ZR 224/05, NJW 2007, 1458, unter II 1 und 2) auch ein
Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1, § 311 BGB in Betracht, wenn
jemand unberechtigt als angeblicher Schuldner außergerichtlich mit einer
Forderung konfrontiert wird und ihm bei der Abwehr dieser Forderung Kosten
entstehen (ebenso LG Zweibrücken, NJW-RR 1998, 1105 f.; AG Münster, NJW-RR
1994, 1261 f.; Palandt/Heinrichs, BGB, 67. Aufl., § 280 Rdnr. 27).
b) Dagegen wird teilweise die Auffassung vertreten, die außergerichtliche
Geltendmachung einer nicht bestehenden Forderung könne nicht anders
behandelt werden als die gerichtliche (KG, Urteil vom 18. August 2005 - 8 U
251/04, juris, Tz. 142; Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen
durch BGH, Beschluss vom 7. Dezember 2006 - IX ZR 167/05,
www.bundesgerichtshof.de, unter 1; OLG Düsseldorf, NJW-RR 1999, 746, unter
2; OLG Braunschweig, OLGR 2001, 196, 198; Grüneberg/Sutschet in:
Bamberger/Roth, BGB, 2. Aufl., § 241 Rdnr. 54). In bestehenden Schuldverhältnissen
gebe es ein Recht, in subjektiv redlicher Weise - wenn auch unter fahrlässiger
Verkennung der Rechtslage - Ansprüche geltend zu machen, die sich als
unberechtigt erwiesen.
c) Nach Ansicht des Senats stellt jedenfalls ein unberechtigtes
Mangelbeseitigungsverlangen nach § 439 Abs. 1 BGB eine zum Schadensersatz
verpflichtende schuldhafte Vertragsverletzung dar, wenn der Käufer erkannt
oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass ein Mangel nicht vorliegt, sondern
die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung in seinem eigenen
Verantwortungsbereich liegt (vgl. zum Werkvertragsrecht LG Hamburg, NJW-RR
1992, 1301; aA OLG Düsseldorf, aaO, und LG Konstanz, NJW-RR 1997, 722,
723). Für den Käufer liegt es auf der Hand, dass von ihm geforderte
Mangelbeseitigungsarbeiten auf Seiten des Verkäufers einen nicht
unerheblichen Kostenaufwand verursachen können. Die innerhalb eines
bestehenden Schuldverhältnisses gebotene Rücksichtnahme auf die Interessen
der gegnerischen Vertragspartei erfordert deshalb, dass der Käufer vor
Inanspruchnahme des Verkäufers im Rahmen seiner Möglichkeiten sorgfältig
prüft, ob die in Betracht kommenden Ursachen für das Symptom, hinter dem
er einen Mangel vermutet, in seiner eigenen Sphäre liegen.
Eine solche Verpflichtung hat entgegen der Auffassung der Revision nicht zur
Folge, dass Käufer ihr Recht, Mangelbeseitigung zu verlangen, so vorsichtig
ausüben müssten, dass ihre Mängelrechte dadurch entwertet würden. Der Käufer
braucht nicht vorab zu klären und festzustellen, ob die von ihm
beanstandete Erscheinung Symptom eines Sachmangels ist (vgl. Malotki, BauR
1998, 682, 688). Er muss lediglich im Rahmen seiner Möglichkeiten sorgfältig
überprüfen, ob sie auf eine Ursache zurückzuführen ist, die nicht dem
Verantwortungsbereich des Verkäufers zuzuordnen ist. Bleibt dabei ungewiss,
ob tatsächlich ein Mangel vorliegt, darf der Käufer Mängelrechte geltend
machen, ohne Schadensersatzpflichten wegen einer schuldhaften
Vertragsverletzung befürchten zu müssen, auch wenn sich sein Verlangen im
Ergebnis als unberechtigt herausstellt. Da es bei der den Käufer treffenden
Prüfungspflicht um den Ausschluss von Ursachen in seinem eigenen
Einflussbereich geht, kommt es entgegen der Auffassung der Revision auf
besondere, die Kaufsache betreffende Fachkenntnisse nicht an, über die
unter Umständen nur der Verkäufer verfügt. Die Annahme einer solchen Prüfungspflicht
steht auch nicht im Widerspruch zu der Entscheidung des IX. Zivilsenats vom
7. Dezember 2006 (aaO), die eine andere Sachverhaltsgestaltung (fehlerhafte
Einschätzung der Rechtslage bei einer vorprozessualen Zahlungsaufforderung)
betrifft.
3. Das Berufungsgericht hat danach eine schuldhafte Vertragsverletzung der
Beklagten zu Recht bejaht. Es hat festgestellt, dass entweder die Beklagte
die von der Klägerin gelieferte Anlage von vornherein fehlerhaft eingebaut
hat, weil sie die erforderliche Kabelverbindung zwischen Alt- und Neubau
nicht hergestellt hat, oder dass ihr Mitarbeiter R. bei der Überprüfung
der Anlage nicht bemerkt hat, dass das Personal des Pflegeheims die
Fehlfunktion durch eine Änderung der Einstellung verursacht hat, und es
zudem nach der Überprüfung versäumt hat, die Verbindung zwischen Alt- und
Neubau wieder anzuklemmen. Jede dieser in Betracht kommenden, im eigenen
Verantwortungsbereich der Beklagten liegenden Ursachen hätte von ihr bzw.
ihren Mitarbeitern (§ 278 BGB) bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt erkannt werden können und deshalb vor Inanspruchnahme der Klägerin
berücksichtigt werden müssen.
Becker &
Becker Rechtsanwälte Niedernhausen 06127-2002
Becker & Becker Rechtsanwälte Eisenach 03691-216418
Becker & Becker Rechtsanwälte Wetzlar 06446-922245